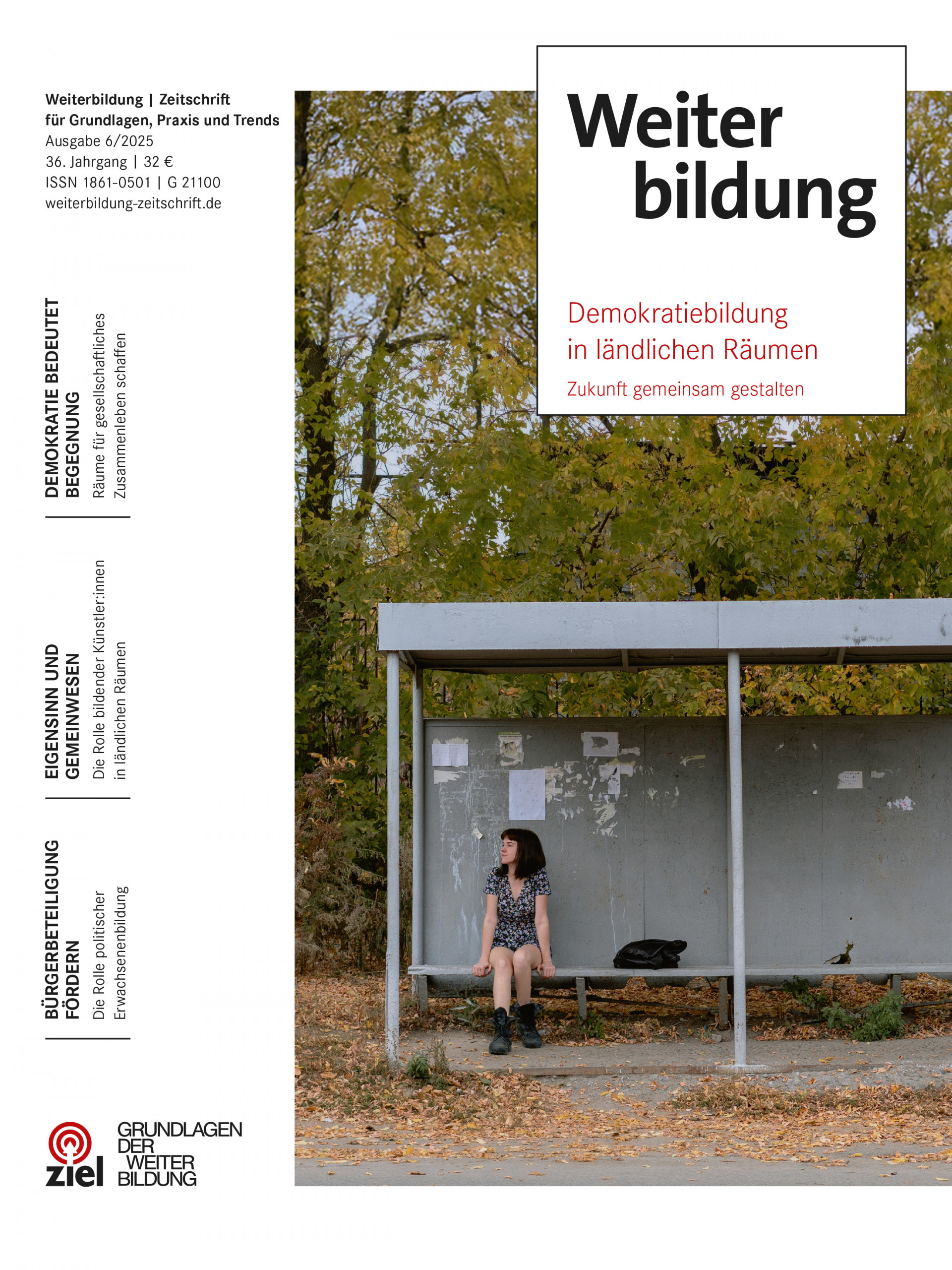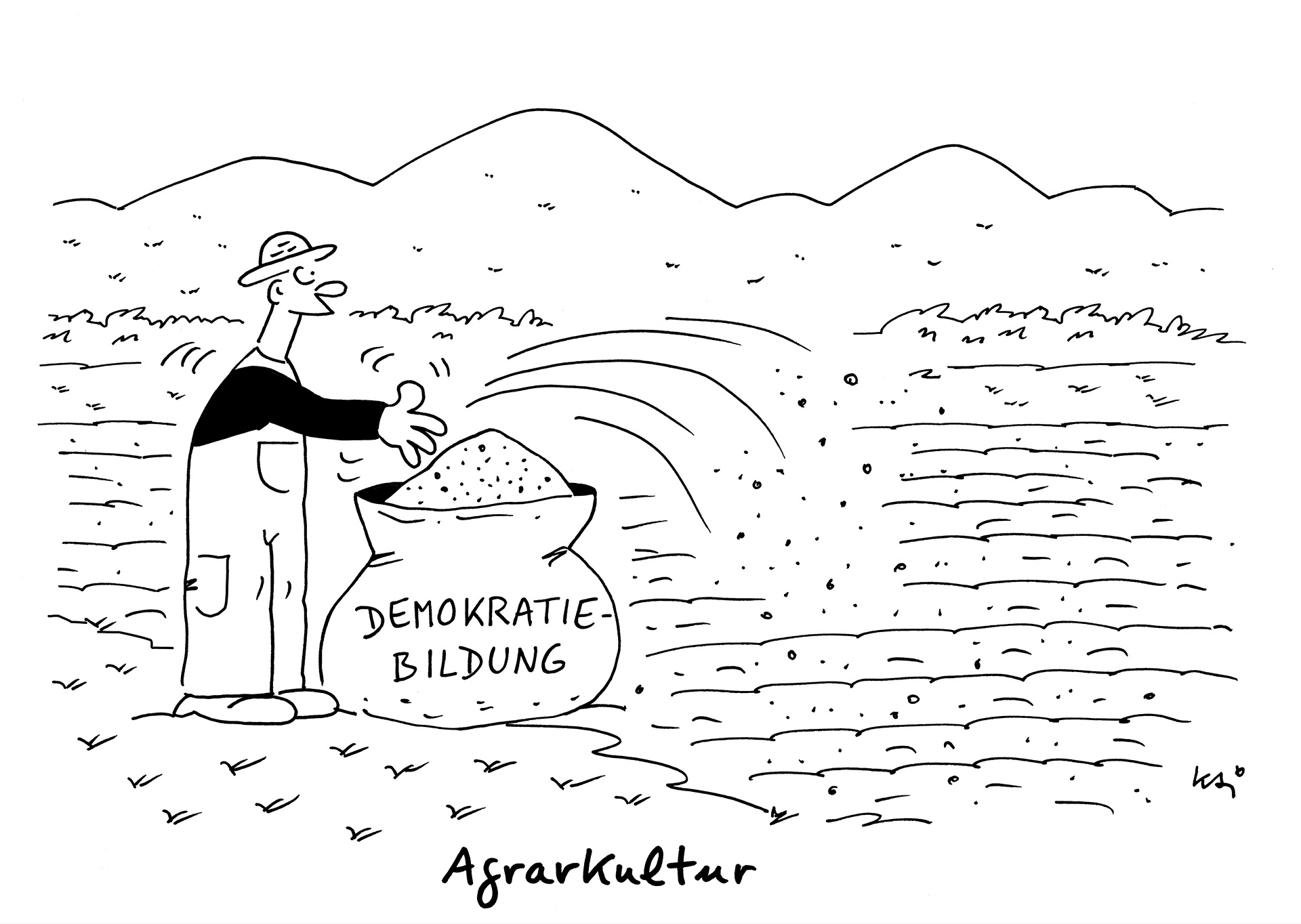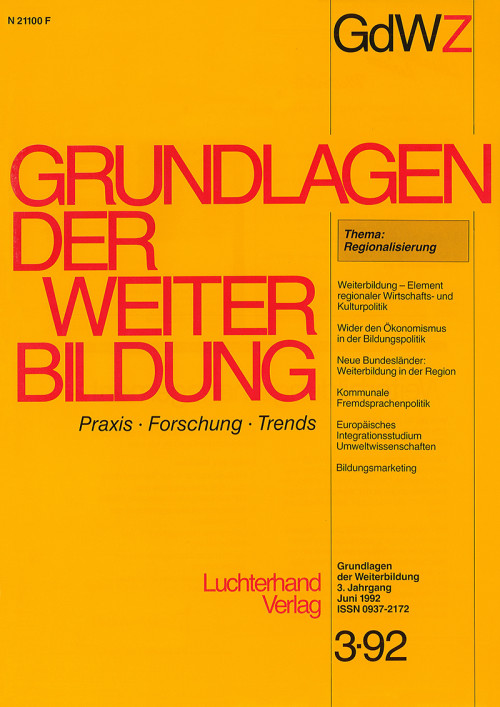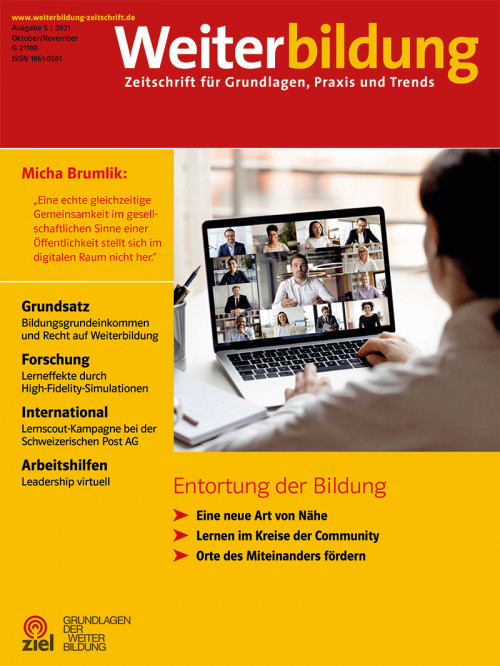Ländliche Räume werden oft aus städtischer Perspektive verklärt oder als rückständig abgewertet. Dadurch gerät aus dem Blick, dass sie eigenständige, vielfältige Lebensräume mit spezifischer Lebensqualität, eigenen Potenzialen und Problemen sind und ihre Beziehungen zu Städten sehr unterschiedlich verlaufen. In politischen Debatten dominiert jedoch die verkürzte Annahme, wirtschaftlich benachteiligte Regionen führten zwangsläufig zu politischer Apathie oder populistischen Erfolgen, obwohl bislang wenig erforscht ist, wie sich materielle Defizite konkret auf demokratische Beteiligung auswirken und wie sich Menschen, die sich als „abgehängt“ erleben, dennoch neue Formen zivilgesellschaftlicher Partizipation aneignen.
Das Heft fragt daher, wie Kommunen und lokale Akteure mit Lern- und Gestaltungsprozessen reagieren und wie erwachsenenbildnerische Ansätze helfen können, Daseinsvorsorge und pluralistische Demokratie zu verbinden. Angesichts der durch Digitalisierung veränderten öffentlichen Räume werden Community-Building, regionale Bildungsnetzwerke und kulturspezifische Initiativen als zentrale Mittel gesehen, um soziale Teilhabe zu stärken, demokratische Kompetenzen zu fördern und ländliche Räume zukunftsfähig zu machen.
Zum Schwerpunktthema „Demokratiebildung in ländlichen Räumen – Zukunft gemeinsam gestalten“
Bürgerbeteiligung ermöglichen und fördern
Ulrich Klemm
Die Rolle der Erwachsenenbildung in ländlichen Räumen hat sich in den 1980er-Jahren mit der Idee der „Eigenständigen Regionalentwicklung“ neu ausgerichtet: Regionale Bildungsarbeit stellte nun den Nahraum und somit das Dorf in den Fokus.
Zwischen Asymmetrie und Inkorporation
Boris Holzer
Das Verhältnis zwischen Zentrum und Peripherie ist immer von Asymmetrien geprägt. Bei der Unterscheidung von Stadt und Land laufen diese meist auf Nachteile der ländlichen Räume hinaus. Andererseits aber rückt durch Inkorporation und Vernetzung des ländlichen Raums das Urbane wieder näher an diesen heran und lässt ihn je nach Perspektive mal als Zentrum, mal als Peripherie erscheinen.
Demokratie bedeutet Begegnung
Rudolf Egger/Sandra Hummel
Ländliche Räume müssen attraktiver für verschiedenste Lebensentwürfe werden, damit die Menschen bleiben. Erwachsenenbildung kann dabei dafür sorgen, dass die Menschen zusammenkommen und Orte und Anlässe finden, wo trotz Differenzen gesellschaftliches Miteinander stattfinden kann.
Eine Ergänzung im Demokratie-Portfolio
Wolfgang Berger/Michael Fischer
Eine fest verankerte demokratische Grundeinstellung der Menschen bedarf, neben Demokratiebildungsmaßnahmen, vor allem auch Demokratieerfahrungen im Alltag. LEADER möchte als zentrale Methode partizipativer Regionalentwicklung solche Erfahrungen fördern.
Eigensinn und Gemeinwesen
Stephan Beetz/Ulf Jacob
Künstler:innen treten auf verschiedenen Ebenen in Beziehung zu ihrem gesellschaftlichen Umfeld. Dazu haben zwei Forschungsprojekte der Hochschule Mittweida mit unterschiedlichen Schwerpunkten untersucht, auf welche Weise Künstler:innen in ländlichen Räumen zur Identifikation mit dem Gemeinwesen beitragen können.
außerdem:
Bernd Käpplinger, Professor für Weiterbildung:
„Es ist wichtig, dass man Bildung, Kultur und Soziales zusammenbringt, auch unter Einschluss des digitalen Raums.“
Abwanderung, verbunden mit weniger finanziellen Ressourcen führt in manchen ländlichen Regionen dazu, als “abgehängt” wahrgenommen zu werden. Hier gilt es, bestehende Möglichkeiten zu nutzen, um einerseits mit Projekten und Initiativen staatlicherseits gegenzusteuern und andererseits der Gemeinschaft Wege aufzuzeigen, Verantwortung zu übernehmen und Ressourcen zu schaffen und zu teilen.